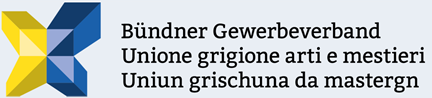«Das Bauen wird sicher umweltbewusster»
16.09.2025

Der ehemalige Churer Stadtpräsident Urs Marti ist seit dem 1. Januar geschäftsführender Präsident des Hauseigentümerverbands Graubünden mit seinen rund 11 200 Mitgliedern. Im Magazin «Bauen Graubünden» äussert er sich zu seiner neuen Aufgabe, zu Vorschriften, zur Eigenverantwortung und zur Rolle des Staats im Wohnungsbau.
Wohnraum ist knapp, Bauen ist teuer, nicht nur wegen der steigenden Material- und Finanzierungskosten. Laut Urs Marti, Präsident des Hauseigentümerverbands Graubünden, sind es vor allem die administrativen Hürden, die den Wohnungsbau in Graubünden ausbremsen. Im Interview spricht er über die Ungleichbehandlung von privaten Eigentümerinnen und Eigen tümern, die problematische Eigenmietwertbesteuerung, überholte Vorschriften und darüber, warum der Staat im Wohnbau oft der falsche Akteur ist.
Urs Marti, der Hauseigentümerverband Graubünden ist die Vereinigung der privaten Liegenschaftsbesitzer in Graubünden. Wie geht es den Hauseigentümern in Graubünden heutzutage?
Im Hauseigentümerverband Graubünden sind rund 11 200 Mitglieder zusammengeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohneigentum schätzen sich viele Mitglieder glücklich, Hauseigentümer zu sein. Nach dem Energiepreisanstieg und dem allgemeinen Kosten- und Zinsschub in den vergangenen zwei Jahren ist wieder eine stabilere Situation festzustellen. Das ist für alle gut. Die steuerliche Belastung ist aber nicht zu unterschätzen. Die Eigenmietwertbesteuerung muss am 28. September als ungerechte und nicht nachvollziehbare Steuer abgeschafft werden.
Welche Hürden erleben private Bauherren und Hauseigentümer in Graubünden aktuell am häufigsten? Was sind die grössten Herausforderungen?
Das Bauen in unserem Kanton hat unglaublich hohe Hürden. Die öffentliche Hand, die Gesetze und dazu noch die Eigendynamik der Verwaltung führen zu allen möglichen Vorschriften und Auflagen in einer Baubewilligung. Ein Blick in eine Baubewilligung zeigt, dass eine solche heutzutage mehrere Seiten an Vorschriften und Auflagen umfasst. Nicht alle sind sinnvoll und nachvollziehbar und es wird überspitzter Formalismus betrieben. Das Bauen verzögert und verteuert sich wegen der administrativen Bürokratie, den heute schwerfälligen Banken, dem Übereifer gewisser Baubewilligungsinstanzen, aber auch durch Einsprachen. Kein Wunder haben wir zu wenig Wohnraum.
Was ist besser als früher?
Viele Hauseigentümer investieren in nachhaltiges Wohnen. Die technischen Möglichkeiten dazu sind in den letzten Jahren besser geworden. Die Qualität des Wohnens und die Architekturqualität haben generell zugenommen.
Werden die Hauseigentümer tatsächlich mehrfach besteuert?
Die Hauseigentümer werden als Milchkühe angesehen. Verschiedene Steuern belasten das private Eigentum, die Hausbesitzer überproportional. Das ist so nicht fair und staatspolitisch falsch. Denn der Eigentümer vertritt wichtige Werte der Schweiz. Die Schweiz basiert auf dem Wert von privat gehaltenem Gut. Da trägt man Sorge. Und eine Steuer ist besonders falsch, nämlich die Besteuerung des selbst bewohnten Hauses und der selbst bewohnten Wohnung. Der Staat verlangt tatsächlich eine Abgabe auf Einnahmen, welche man gar nicht hat. Dieser unsägliche Eigenmietwert, ein Fossil, sollte nun endlich abgeschafft werden.
Wie unterscheidet sich das Bauen von Privaten im Vergleich zu anderen Kantonen, insbesondere in Bezug auf Vorschriften und topografische Gegebenheiten?
Wir haben zu viele Regelungen, auch noch unterschiedlich pro Gemeinde. Die Topografie und die Sicherheit verteuern das Bauen in Graubünden und das Land ist knapp und daher auch teuer. Für einen Kanton mit etwas schwächerer Wirtschaftskraft ist der Gesetzgeber gefordert, Vereinfachungen anzustreben. Gemacht wird aber genau das Gegenteil.
Was ist im Umgang mit Hauseigentümern zu beachten?
Die Gesellschaft schätzt zu wenig, dass Hauseigentümer ihr Geld in der Schweiz anlegen, Handwerkern Arbeit geben, viel Steuern bezahlen. Das Erfolgsmodell Schweiz gründet auch auf den Hauseigentümern. Allzu oft sind Neiddebatten feststellbar.
Welche Vorteile hat die Baubranche von privaten Wohneigen tümern im Vergleich zu Investoren und der öffentlichen Hand?
Ich denke, dass sich beide Seiten bewusst sind, dass es beide gegenseitig braucht. Die Partnerschaft geht mehr auf Augenhöhe und ist auf Kontinuität aufgebaut.
Warum sollten auch Unternehmerinnen und Unternehmer Wohneigentum und Gewerbeeigentum haben?
Natürlich kommt dies auf die Geschäftsstrategie an. Aber im Grundsatz investiert man sinnvollerweise das verdiente Geld wiederum in langfristige Anlagen, welche man selbst benutzt. Damit kann man sparen und besser kalkulieren. Ich freue mich immer, wenn Unternehmer hier investieren. Dann schaffen sie auch Arbeitsplätze.
Was müssen Unternehmer beim Wohneigentum beachten?
Es darf nicht zu viel Liquidität binden und muss wiederverkäuflich sein, wenn die Unternehmung Kapital braucht.
Was ist bei der Finanzierung von Eigentum für Unternehmer zu beachten?
Da eine Unternehmung oder der Markt sich rasch wandeln kann, ist der Investitionsdauer und Amortisationsdauer Beachtung zu schenken. Die ursprüngliche Nutzung hält zumeist nicht so lange, wie ein Gebäude zunächst in der Geschäftsstrategie vorgesehen war, meistens kürzer. Eine geschäftliche Veränderung muss möglich sein. Das Gebäude muss daher flexibel nutzbar geplant werden.
Welche Unterschiede zwischen Wohneigentum und Geschäftseigentum sind zu beachten?
Für Wohneigentum gibt es einfacher Nachfolgekäufer. Weil eben Geschäftsliegenschaften zu spezifisch sind oder sogar Auflagen der öffentlichen Hand Umnutzungen erschweren, ist es oftmals schwieriger, diese zu veräussern. Die Finanzierung bei den Banken ist auch völlig anders aufgebaut.
Hat der Immobilienbesitz für die Sicherung und Weiterent wicklung eines Unternehmens eine grosse Bedeutung?
Es ist von Vorteil, in einer eigenen Immobilie rasch und kostengünstig Anpassungen in der geschäftlichen Tätigkeit zu verwirklichen. Auch kann man nicht zu einem Umzug gezwungen werden. Zudem ist es oftmals günstiger dank Amortisationen und Zinseinsparungen.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation bezüglich Bauland verfügbarkeit und Bodenpreise in Graubünden?
Die Situation ist schwierig, Land ist knapp und teuer. Auf der anderen Seite haben gewisse Talschaften umgekehrt die Frage, Firmen und Einwohner zu halten. Ich empfehle eine überkommunale Landstrategie. Zum Beispiel ist das Bündner Rheintal raumplanerisch nicht gut aufgestellt. Wirtschaftlich wird das Ganze zu kleinräumig organisiert. Umgekehrt fehlen Anreize für eine Gemeinde, auch auf etwas zu verzichten, wo es anders besser hinpasst. Hier wären Gemeindereformen notwendig und gut.
In der Verfassung steht, dass Hauseigentum gefördert werden soll. Wird dieser Verfassungsauftrag von Bund, Kantonen und Gemeinden heute wahrge nommen? Was können Kanton und Gemeinden besser machen?
Die Förderung wird zu wenig wahrgenommen. Die Verbesserungen sind in der Baugesetzgebung und deren pragmatischen Handhabung zu suchen. Gleichzeitig sind die Steuern anzupassen, der Eigenmietwert zu streichen.
Was fordert der Hauseigentümerverband von Politik und Verwaltung, um das Bauen zu erleichtern und zu fördern?
Wichtig wäre, einen klaren Willen zu spüren, das Wohnen und das Eigentum zu fördern und zu schützen. Die Verwaltung soll zu Lösungen beitragen, statt Verbote und Regulierungen vorzuschreiben. Die Politik muss mehr kontrollieren und steuern, dass die Bürokratie abnimmt.
Was halten Sie davon, dass Gemeinden vermehrt als Investoren im Wohnungsbau auftreten?
Der Staat hat andere Aufgaben und muss das Geld in eine moderne Infrastruktur investieren. Schulhäuser, Sport- und Freizeitanlagen, Strassen und auch technische Bauten für Wasser, Wärme und Strom sind wichtigste Aufgaben des Staats. Es ist also falsch, wenn der Staat zum Player auf dem Wohnungsmarkt wird. Besser würde er sich endlich dafür einsetzen, dass Eigentum realisierbar wird. Auch Darlehen an Genossenschaften bringen nichts. Die Zinseinsparung hat wenig Einfluss. Die Baugesetzgebung muss liberaler werden. Dann wird mehr gebaut. Der Staat sollte als Hilfe die Eigenmietwertbesteuerung fallen lassen. Der Immobilienmarkt ist und bleibt ein Markt, welcher privat besser funktioniert. Man darf sich nicht täuschen lassen. Der Staat hat im Wohnungsmarkt in der Regel schlechte Voraussetzungen. Die Menge an Wohnungen, welche es braucht, kann er gar nicht finanzieren. Er baut zudem teurer und perfekter als Private und er verliert umgekehrt an Steuereinnahmen, wenn er Wohnungen zum Selbstkostenpreis anbietet. Einv
Wie sieht Ihrer Meinung nach das Bauen in Graubünden im Jahr 2040 aus – und was braucht es, damit es bezahlbar, nachhaltig und regional verankert bleibt?!
Das Bauen wird sicher umweltbewusster. Die Materialien werden wiederverwendet und ändern sich auch in Form und Aussehen. Die Gebäude werden anders aussehen, weil die Nutzungen sich verändern. Eine Utopie bleibt wahrscheinlich, dass es günstiger und einfacher werden wird.
Hauseigentümerverbands Graubünden
Gründung: 1982
Mitarbeiter: Gegliedert in 8 Sektionen mit eigenen Vorständen und Teilzeitgeschäftsstellen. Die Geschäftsstelle Graubünden ist in Chur angesiedelt und hat einen Teilzeitumfang von ca. 50%
Mitglieder: 11146 Mitglieder (Stand 1. Januar 2025)
Mitgliederbeitrag: Je nach Sektion zwischen Fr. 45.– und Fr. 70.– im Jahr für eine Wohnung/ein Einfamilienhaus. Er beinhaltet Beratung, Formulare, Fachwissen und Informationsbulletins.
Kontakt: Hauseigentümerverband Graubünden, Grabenstrasse 40, 7000 Chur
Telefon: 081 250 50 33