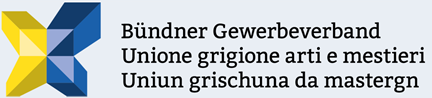«Der Kanton will die Berufsbildung stärken»
20.10.2025

Die Bündner Wirtschaft ist auf eine starke Berufsbildung angewiesen. Der BGV hat vor einem Jahr seine Berufsbildungsstrategie publiziert. Ebenfalls möchte der Kanton im Rahmen des Regierungsprogramms die Berufsbildung stärken.
An der Berufsbildung sind Arbeitgeber, Wirtschaft und öffentliche Hand gleichermassen beteiligt. Dies gilt auch für die Weiterentwicklung und Stärkung der Berufsbildung in Graubünden. Die Regierung möchte die Berufsbildung im Rahmen des laufenden Regierungsprogramms stärken. In die gleiche Richtung zielt ein Auftrag von Grossrat, Unternehmer und Mitglied des Kantonalverbandes des BGV, Jürg Heini, zur Stärkung der Berufsbildung in Graubünden, den er 2023 im Grossen Rat eingereicht hat. Über die Entwicklungen in der Berufsbildung sowie die Bestrebungen des Kantons, haben wir mit Regierungsrat und Bildungsminister Dr. Jon Domenic Parolini gesprochen.
Herr Regierungsrat Parolini, wie würden Sie die aktuelle Situation der Berufsbildung in Graubünden beschreiben?
Die Berufsbildung im Kanton Graubünden ist tief verwurzelt und stark. Rund 80 Prozent der Jugendlichen auf Sekundarstufe II absolvieren eine berufliche Grundbildung. Diese steht bei den Schulabgängerinnen und -abgängern in Graubünden nach wie vor an erster Stelle. Die Berufsbildung in Graubünden steht vor verschiedenen Weichenstellungen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und veränderte Rahmenbedingungen will die Regierung die Berufsbildung stärken. Die «Stärkung der beruflichen Grundbildung» ist ein Schwerpunktthema der Regierung für die Jahre 2025–2028. Zudem möchte die Bündner Regierung die Höhere Berufsbildung in Graubünden gezielt ausbauen und fördern. Um dies zu erreichen, gilt es, für den entsprechenden materiellen und rechtlichen Spielraum zu sorgen.
Was sind die grössten Herausforderungen in der Berufsbildung in Graubünden aus Ihrer Sicht?
Die rückläufige Geburtenentwicklung der letzten Jahre wirkt sich spürbar auf die Lernendenzahlen aus. Zwischen 1980 und 2000 wurden im Kanton Graubünden durchschnittlich 2'160 Geburten verzeichnet, zwischen 2001 und 2024 noch 1'666 Geburten, im Jahr 2024 und mit 1'504 ein historischer Tiefstand. Entsprechend sinkt die Zahl der Lernenden, während die Anzahl der beruflicher Grundbildungen und Lehrstellen weitgehend stabil bleiben. Dies beeinflusst die Klassengrössen an den Berufsfachschulen und künftig auch die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte.
Inwiefern unterscheidet sich die Situation in Graubünden von derjenigen in anderen Kantonen?
Graubünden ist flächenmässig der grösste, zugleich aber auch der am dünnsten besiedelte Kanton der Schweiz – und der einzige mit drei Kantonsprachen. Hinzu kommt die topografische Situation unserer Region. Auch das Bevölkerungswachstum in Graubünden liegt im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt unter dem Mittel.
Die Berufsbildung ist eine Verbundsaufgabe, einerseits zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand und andererseits zwischen Bund und Kantonen. Wie erleben Sie Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren?
Seit dem Jahr 2019 stehe ich dem Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement vor und durfte feststellen, dass die Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung gut funktioniert. Dies habe ich insbesondere auch während der Covid-19 Pandemie festgestellt. Es ist gelungen, über die ganze Schweiz hinweg und mit allen Verbundpartnern gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und diese in den Kantonen und Lehrbetrieben umzusetzen. Dagegen die Fünfjahresüberprüfungen der jeweiligen beruflichen Grundbildungen können die Organisationen der Arbeit, die Kantone und der Bund sicherstellen, dass diese aktuell und dem Bedarf der Wirtschaft entsprechen. Vom 12. bis zum 16. November 2025 findet die grösste Berufsausstellung in Graubünden, nämlich die Fiutscher, in Chur statt. Hier zeigt sich die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Partnern der Berufsbildung.
Der BGV begrüsst es, dass die Regierung im Rahmen des aktuellen Regierungsprogramms die Berufsbildung stärken möchten. Welche konkreten Massnahmen sind geplant?
Im Bereich der beruflichen Grundbildung werden zwischen den Jahren 2025 und 2028 in einem ersten Schritt neue Modelle des Berufsfachschulunterrichts, die Strukturen der Brückenangebote und der Berufsfachschulen sowie die Finanzierungmöglichkeiten im Bereich der Lehrbetriebe, der überbetrieblichen Kurse und weiterer Massnahmen geprüft. In einem zweiten Schritt werden dazu Empfehlungen abgeleitet, welche als Grundlage für die anschliessende Erarbeitung einer Strategie zur Stärkung der beruflichen Grundbildung in Graubünden dienen. Im Bereich der Höheren Berufsbildung haben wir zwischen dem 19. Dezember 2024 und dem 19. März 2025 die Vernehmlassung zum neuen Gesetz über die Höhere Berufsbildung durchgeführt. Aktuell laufen die Auswertungen und Vorbereitungen, damit das Gesetz im Jahr 2026 dem Grossen Rat unterbreitet werden kann.
Wie sehen die Zahlen bei den Weiterbildungen an, vor allem in der höheren Berufsbildung. Ist die Zahl der Absolventinnen dort auch gesunken in den letzten zehn Jahren?
Der Kanton erfasst selbst im Bereich der Weiterbildung keine Zahlen. Im Tertiärbereich erhebt das Bundesamt für Statistik nur Zahlen, ob eine Weiterbildung in den letzten zwölf Monaten oder in den letzten fünf Jahren besucht wurde. Vergleicht man die Studierendenzahlen im Bereich der Höheren Berufsbildung im Kanton Graubünden an, so kann festgestellt werden, dass die Zahlen seit 2010 (rund 1400 Studierende) stetig gestiegen sind und der Höhepunkt im Schuljahr 2021/2022 (2264 Studierende) erreicht wurde. Seitdem hat sich der Wert erfreulicherweise bei rund 1900 Studierenden stabilisiert.
Welche Rolle hat der Kanton im Bereich der Weiterbildungen?
Vorab, grundsätzlich sind verschiedenen Ausbildungswege zu unterscheiden: Weiterbildung umfasst strukturierte Bildungsangebote wie organisierte Kurse oder Lernprogramme, die nicht zu staatlich anerkannten Abschlüssen führen und als non-formale Bildung bezeichnet werden. Die formale Bildung hingegen bezeichnet staatlich geregelte Ausbildungswege, die zu offiziellen Abschlüssen wie Berufsabschlüssen der höheren Berufsbildung, akademischen Graden führen. Hier sprechen wir vom Tertiärbereich. Der Tertiärbereich umfasst die Höhere Berufsbildung und den gesamten Hochschulsektor. Im Bereich der formalen Bildung verfügt der Kanton über eigene Kompetenzen. Der Kanton schafft die gesetzlichen Grundlagen für die Bildungseinrichtungen und unterstützt diese durch finanzielle Beiträge via Leistungsaufträge oder Rahmenkontrakte. Bei den Bildungseinrichtungen ist zu unterscheiden zwischen solchen, welche direkt vom Kanton getragen werden und solche welche privat getragen werden. Um den neuen Herausforderungen im Bereich der non-formalen Weiterbildung gerecht zu werden, ist für die kommende Regierungsperiode geplant das Gesetz über die Unterstützung der Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener im Kanton Graubünden zu revidieren.
Lebenslanges Lernen gehört schon länger zur beruflichen Laufbahn eines jeden dazu. Was unternimmt der Kanton in diesem Bereich, um die Bündner Bevölkerung fit für den Arbeitsmarkt zu halten?
Die Regierung hat beispielsweise per 1. Januar 2022 die Kostenpflicht für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen für alle in Graubünden wohnhaften Personen aufgehoben. Damit hat sie für alle in Graubünden wohnhaften Personen den Zugang zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung unabhängig von sozialer Stellung, Alter und Vorbildung geöffnet. Da sich die Arbeitswelt rasch wandelt und um die Arbeitsmarktfähigkeit bis zur Pensionierung zu erhalten, muss die eigene Laufbahn aktiv gestaltet werden. Dafür bietet die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Amts für Berufsbildung ebenfalls seit dem Jahr 2022 unter dem Titel «viamia» für Personen ab dem 40. Lebensjahr eine kostenlose Standortbestimmung an. Dabei werden die persönliche und berufliche Situation und Entwicklungsmöglichkeiten mit einer Fachperson besprochen.
Aktuell erleben wir durch Künstliche Intelligenz (KI) einen rasanten Wandel in der Arbeitswelt. Die in der Arbeitswelt benötigten Grundkompetenzen verändern sich damit auch. Welche Rolle spielt der Kanton, dabei die Menschen durch Weiterbildung im Arbeitsmarkt zu halten?
Künstliche Intelligenz sowie andere neuartige Technologien sind ein wichtiger Aspekt der digitalen Transformation und führen zu wesentlichen Veränderungen in sämtlichen Lebensbereichen. Die Regierung ist sich der grossen Tragweite dieser Entwicklungen bewusst. KI-Anwendungen schaffen neue Perspektiven. Diese Thematik betrifft jedoch nicht nur einen einzelnen Kanton, sondern erfordert eine koordinierte Herangehensweise auf nationaler und internationaler Ebene. Der Kanton verfolgt die Entwicklungen in diesem Bereich aufmerksam. Bei der Weiterverfolgung der integrierten Bildungs-, Forschungs- und Innovationsstrategie des Kantons Graubünden wird im Teilprojekt MINT der KI-Bereich hoch gewichtet.
Wie können Jugendliche ihrer Meinung nach am besten auf eine Arbeitswelt vorbereitet werden, die sich ständig verändert?
Jugendliche sind am besten auf eine sich wandelnde Arbeitswelt vorbereitet, wenn sie neben fachlichem Wissen auch überfachliche Kompetenzen – personale, soziale und methodische –, Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft entwickeln. Der Lehrplan 21 GR trägt diesem Umstand Rechnung und fördert diese Kompetenzen fächerübergreifend.
Was raten sie den Jugendlichen und ihren Eltern, die gerade in der Berufswahl stehen?
Der Berufswahlprozess ist voller Möglichkeiten, kann aber auch herausfordernd sein. Es ist hilfreich, sich an den sieben Schritten der Berufswahl und am Berufswahlfahrplan zu orientieren. Wertvoll ist es, wenn die Eltern ihre eigene Berufswelt erklären und den Jugendlichen von eigenen Erfahrungen erzählen. Eltern können sich gemeinsam mit den Jugendlichen über Berufe und Bildungswege informieren, Gespräche über die schulischen oder beruflichen Zukunftsvorstellungen führen und Anregungen geben. Entscheidend ist, dass Jugendliche spüren, dass Eltern ein offenes Ohr für ihre Ideen und Fragen haben und schlussendlich eine Berufswahl treffen können. Die Lehrpersonen der Volksschule nehmen im Rahmen der beruflichen Orientierung einen bedeutsamen Stellenwert für die Berufsfindung ein und werden durch die Angebote der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ergänzt. Weder die Jugendlichen noch die Eltern sind also allein auf diesem Weg.
Mit dem Lehrplan 21 GR wurde die Berufswahl in den Schulen gestärkt. Wie beurteilen sie die Berufswahl an den Bündner Oberstufen heutzutage?
Mit der Einführung des Lehrplans 21 GR wurde der Berufswahl im Volksschulbereich mehr Bedeutung verliehen. Neben dem Fach «Berufliche Orientierung» in der 2. Klasse der Sekundarstufe I (Oberstufe) wird die Berufswahl auch in anderen Fächern thematisiert und vermittelt. Insbesondere im Fachbereich «Individualisierung» in der 9. Klasse wird ein starker Akzent auf eine individuelle Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die berufliche Grundbildung oder auf allgemeinbildende Schulen gelegt.
Eine Umfrage bei den Lehrbetrieben vor zwei Jahren, die der BGV zusammen mit dem Amt für Berufsbildung durchgeführt hat, hat gezeigt, dass es bei der Berufswahl vor allem in der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Lehrbetrieben hapert. Was unternimmt der Kanton, um die Berufswahl in diesem Bereich zu verbessern?
Ich habe regelmässig Kontakt mit den Volksschulen und stelle fest, dass die Schülerinnen und Schüler gut über die künftigen Möglichkeiten informiert sind und viele, schon am Anfang der Sekundarstufe I, eine klare Vorstellung davon haben, wohin die Reise später gehen soll. Die Volksschulen erkunden bereits auf Primarstufe im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» mit den Schülerinnen und Schülern die Arbeitswelt. Auf der Sekundarstufe I (Oberstufe) intensiviert sich dies natürlich. Nebst dem Lehrplan 21 GR sind auch Gefässe wie der Nationale Zukunftstag oder Fiutscher sowie die klassische Schnupperlehre beste Gelegenheiten, den Schritt aus der Theorie in die Praxis zu machen. Insgesamt funktioniert die Berufswahlvorbereitung in Graubünden gut – das zeigen auch die hohen Abschlussquoten in der beruflichen Grundbildung.
Die Regierung möchte im Rahmen des aktuellen Regierungsprogramms die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bildungsinstitutionen und der Wirtschaft stärken, was der BGV sehr begrüsst. Können sie bereits zu konkreten Massnahmen etwas sagen?
Der Wissens- und Technologietransfers (WTT) ist sehr wichtig. Zur Förderung des WTT soll der Austausch zwischen allen Bildungsstufen und der Wirtschaft gefördert werden. Das EKUD startet keine direkten Massnahmen mit der Wirtschaft, sondern sorgt für die Koordination zwischen den Departementen und sorgt für gute Rahmenbedingungen bei den Bildungseinrichtungen. Daraus können interessante und intern gut koordinierte WTT-Projekte entstehen, auch in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Aktivtäten im Bereich der Forschung in Graubünden.
Warum plant der Kanton die Einführung eines Gesetzes zur höheren Berufsbildung (GHB)?
Der Kanton Graubünden hat diese Notwendigkeit der Stärkung der Höheren Berufsbildung bereits 2023/2024 mit den Arbeiten an einem eigenen Erlass für die Höhere Berufsbildung begonnen. Dass die Höhere Berufsbildung im Tertiärbereich als eigenständiger Bildungsbereich in einem eigenen Erlass geregelt werden soll, ist in der Schweiz bisher noch einzigartig und soll die grosse wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Höheren Berufsbildung für unseren Kanton zum Ausdruck bringen. Namentlich mit Blick auf die besonderen räumlichen, wirtschaftlichen und demografischen Bedingungen des Kantons Graubünden sollen auf der Tertiärstufe die beiden Bereiche «Höhere Berufsbildung» und «Hochschulen» durch eigenständige Gesetze geregelt werden. Mit dem neuen Erlass soll die Höhere Berufsbildung in Graubünden an Sichtbarkeit gewinnen und zudem soll ihre Positionierung gestärkt werden, damit sie sich bestmöglich weiterentwickeln kann.
Welche Neuerungen im Vergleich zu heute beinhaltet das Gesetz voraussichtlich?
Das neu zu schaffende Gesetz über die Höhere Berufsbildung und das bestehende Gesetz über Hochschulen und Forschung sind zwei zueinander komplementäre Gesetze. Sie widerspiegeln die Bedeutung des dualen Bildungssystems auf Tertiärstufe mit einem jeweils stark ausgeprägten praxisorientierten bzw. wissenschaftlichen Fokus. Damit die Rahmenbedingungen für die Institutionen der Höheren Berufsbildung den Anforderungen gerecht werden können, soll neben der heute geltenden Defizitfinanzierung auch eine Pauschalfinanzierung ermöglicht werden.
Zu guter Letzt: Was wünschen Sie sich von den Unternehmen und Arbeitgeber im Kanton, um die Berufsbildung zu stärken?
Die Unternehmen sollen weiterhin tatkräftig Aus- und Weiterbildung ihrer Lernenden und Mitarbeitenden unterstützen sowie die Aufgaben in der Verbundpartnerschaft wahrnehmen. Wichtig ist ebenfalls, dass sie kluge und angepasste Werbung für die Lehrstellen ihrer Branche machen.
Drei persönliche Fragen an Regierungsrat Parolini
Sie haben das Wirtschaftsgymnasium in Samedan besucht, danach an der ETH Forstwirtschaft studiert und anschliessend doktoriert. Sie sind also ein «Studierter». Wie haben sie damals die Berufswahl an der Oberstufe erlebt?
Damals gab es den heutigen Lehrplan noch nicht und die Berufswahl in der Schule erfolgte weniger organisiert und strukturiert als heute. Meine damalige Lehrperson engagierte sich jedoch stark und unterstützte uns bestmöglich - wie es auch die Lehrpersonen heute tun. Die Voraussetzungen sind inzwischen bedeutend besser und die Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen Volksschule und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sind klarer strukturiert.
Was würden Sie heute lernen, wenn sie nochmals jung wären?
Rückblickend hat mein gewählter Weg gut zu mir gepasst. Heute weiss ich, dass unser hervorragendes Bildungssystem Dank seiner Durchlässigkeit vielfältige Wege und Möglichkeiten bietet, um den passenden Beruf oder die richtige Aus- oder Weiterbildung zu finden.
Es gibt in der Schweiz keine Lehre und kein Studium für Politiker. Was ist die beste Ausbildung für einen Regierungsrat?
Die richtige Ausbildung ist jene, die den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen am besten entspricht. Das politische System der Schweiz stützt sich auf das Milizprinzip, wonach viele politische Ämter meist nebenberuflich ausgeübt werden. Gerade darin liegt eine grosse Stärke, dass Personen mit unterschiedlichen beruflichen und schulischen Hintergründen, verschiedenen Kulturen, Sprachen etc. gemeinsam nach Lösungen für unser Land suchen. Oft gilt auch «Learning by Doing». Ich habe vorerst als Gemeindevorstandsmitglied, dann als Präsident des Regionalverbandes und danach als Gemeindepräsident von Scuol und Grossrat, Schritt für Schritt meine politische Laufbahn aufgebaut und dabei sehr viel auch für meine jetzige Arbeit als Regierungsrat gelernt.
Die Berufsbildung in Zahlen
Über 2600 Lehrbetriebe bieten in 160 Berufen Ausbildungsplätze für Jugendliche und Erwachsene an und schliessen jährlich rund 2000 neue Lehrverhältnisse ab. Die 20 Berufe, welche am meisten gewählt werden, decken rund zwei/Drittel der Lernende ab. 93.4 Prozent der 25-jährigen Personen im Kanton Graubünden verfügen über einen Abschluss auf Sekundarstufe II, was dem fünfthöchsten Wert der Schweiz entspricht. Auch die Höhere Berufsbildung ist gut verankert. Rund 1700 Studierende besuchen höhere Fachschulen in Graubünden. Von diesen haben rund die Hälfte ihren ständigen Wohnsitz in Graubünden Mit 17 Prozent weist Graubünden zudem die sechsthöchste Berufsmaturitätsquote der Schweiz aus. Unter anderem ermöglicht das Berufsmaturitätszeugnis den prüfungsfreien Zutritt an eine Fachhochschule.