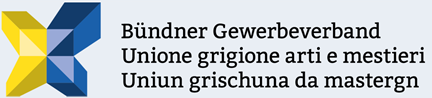1950 - 1975: Die goldenen Jahre
25.08.2025

Die Befürchtungen vieler Experten nach dem 2. Weltkrieg in Wirtschaft und Politik, aber auch der Bevölkerung, dass sich die Wirtschaft wie nach dem 1. Weltkrieg nur langsam erholen würde, trafen nicht ein. Steigende Preise, soziale Unruhen, Streiks und hohe Arbeitslosigkeit gab es keine mehr in Europa.
Weitsichtige Politiker erkannten, dass sich nur ein befriedetes und prosperierendes Europa unter Einbezug der Verlierermächte rasch erholen würde. Dies war der Start zur wirtschaftlichen Integration Europas, die zwar nicht reibungslos, im Grossen und Ganzen aber erfolgreich verlaufen sollte. Die Schweiz konnte sich von Beginn weg an diesem generellen Aufschwung beteiligen. Als grossen Vorteil wies sie im Gegensatz zu den Nachbarländern zudem über unversehrte Unternehmungen und eine intakte Infrastruktur auf. Die allgemeine Stimmung wurde dank hoher Exporte und beträchtlicher Investitionen zunehmend optimistischer. Leichte Rückschläge für die Schweizer Wirtschaft gab es in den Nachkriegsjahren nur 1949 und 1958. Begünstigt wurde der Wachstumsschub durch billige ausländische Arbeitskräfte und eine niedrige Bewertung des Schweizerfrankens, was schon kurze Zeit nach Kriegsende im Tourismus zu einer gesteigerten Nachfrage ausländischer Gäste führen sollte.
Drei Treiber: Tourismus, Kraftwerks- und Strassenbau
Davon konnte auch Graubünden profitieren, wo der Aufschwung aufgrund der Wirtschaftsstruktur (wenig Industrie, kaum Finanzdienstleistungen) zwar verzögert einsetzte, aber dank des Tourismus bereits 1946 mit vier Millionen Logiernächten wieder den Stand von 1930 aufwies. Bis 1954 verharrte die Entwicklung auf diesem Niveau, dann setzte ein starkes und kontinuierliches Wachstum ein, das 1973 mit 13,8 Millionen Logiernächten (inklusive Parahotellerie) einen vorläufigen Höhepunkt erreichen sollte.
Neben dem aufstrebenden Tourismus trugen in dieser Phase zwei weitere Impulse wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung in Graubünden bei. Der Bau der meisten Wasserkraftwerke fiel in diese Zeit. Zudem stimmten Volk und Stände 1960 dem Verfassungsartikel über das Nationalstrassennetz zu, was sich in Graubünden im Bau der A13 zeigte und 1967 in der Eröffnung des San-Bernardino-Tunnels gipfelte. Der Strassenverkehr erlangte zunehmende Bedeutung. Von 1945 bis 1970 stieg der Motorfahrzeugbestand von 1000 auf 44 000. Die Blütezeit des Bündner Autogewerbes stand an ihrem Anfang – und das nur 20 Jahre nach der Aufhebung des allgemeinen Fahrverbots.
Vom letzten auf den 14. Rang
Gehörte Graubünden bis zur Mitte der Fünfzigerjahre traditionell zu den Kantonen mit dem niedrigsten Wohlstandsniveau, sollte sich dies aufgrund der erwähnten Entwicklung nun rasch ändern. 1970 erreichten die in Graubünden ansässigen Personen rund 90% des schweizerischen Durchschnitts des Volkseinkommens, oder anders gesagt: Vom Schluss der Rangliste schaffte man es immerhin auf den 14. Platz aller (damals noch 25) Kantone. Die Einkommens- und Vermögenssteuern des Kantons 1970 fielen mit 99 Millionen Franken sechsmal höher aus als 1955.
Der BGV stellt sich neu auf
Im Bündner Gewerbeverband durfte man sich über diese Entwicklung freuen, wenn dies auch in den vielen Jahresberichten und Jubiläumsschriften nur wenig zum Ausdruck kommt. Das hatte seine Gründe. Die Nachkriegsjahre wurden für die vielen kleinen und kleinsten Betriebe zur Tortur. Denn durch das sogenannte Vollmachtenrecht des Bundesrates musste im Krieg die direkte Demokratie höheren Interessen geopfert werden. Die Gesetzesmaschinerie und die Gesetzesinflation nahmen nach Kriegsende aber dann vor allem zu Beginn der 50er-Jahre ihren Lauf. «Um einseitige Lösungen und Überbordungen zu verhindern» (wie der damalige Sekretär Dr. Josias Grass schrieb), sei es notwendig, die Selbstständigerwerbenden zu schützen.
Grass erkannte, dass das Gewerbe seine Stimme in Vorberatungen, Konferenzen, Kommissionen, Parlamenten sowie in den Medien und Volksabstimmungen erheben musste. Der Verbandsführung gelang es dank geschickter organisatorischer Massnahmen und Optimierung der Verbandsfinanzen, den BGV neu zu positionieren. Um verbandsintern den Austausch zu fördern, wurde neben der geglückten Aufteilung der strategischen Führung in Kantonalvorstand sowie in den Gruppen Detailhandel und Bauwesen mit eigenen Kompetenzen neu die Präsidentenkonferenz geschaffen, in der die ordnungspolitischen Geschäfte behandelt wurden. Der Verband begann zu wachsen. Von 50 Sektionen mit 3300 Mitgliedern im Jahre 1945 bis zu 66 Sektionen mit 4450 Mitgliedern im Jahre 1956.
Wiedergeburt des früheren Vororts
Der Bündner Gewerbeverband blieb nicht bei den eigenen Grenzen stehen. Er wusste, dass er zur Durchsetzung seiner Anliegen Verbündete im Kanton mit ähnlich gelagerten Interessen brauchte. In beharrlichen Anläufen, die nicht immer von Erfolg gekrönt waren, gelang im Oktober 1953 die Wiedergeburt des früheren Vororts, der neu «Vereinigung der Bündner Wirtschaftsverbände» genannt wurde. Der Vereinigung gehörten neben dem BGV, dem Bündner Handels- und Industrieverein, dem Bündner Hotelierverein, dem Bündner Bauernverband auch der Verkehrsverein für Graubünden an. Das Präsidium wechselte und wurde zuerst vom BGV geführt.
Die fünf Organisationen schrieben sich auf die Fahne, zu allgemeinen volkswirtschaftlichen Problemen Graubündens, Fragen der Rhätischen Bahn, des Strassenbaus, des Verkehrs, des San-Bernardino-Durchstichs oder der Fremdarbeiterthematik Stellung zu nehmen. Aber die Trägerschaft sollte auch dazu dienen, die Probleme des «anderen» zu verstehen und die Solidarität unter den bedeutendsten Exponenten der Privatwirtschaft zu stärken. Bei den Projekten der Ostalpenbahn mit einem Splügenbasistunnel bzw. einem Splügenstrassentunnel musste der BGV alleine vorangehen. Er führte über längere Zeit das Sekretariat des Initiativkomitees, was wohl auch mit einem der glühendsten Verfechter jener Zeit zu tun hatte. Jakob Schutz, später Regierungsrat und Nationalrat, stand dem BGV in dieser Zeit als Präsident vor. Dem Projekt blieb nach 150 Jahren Kampf kein Erfolg beschieden.
An vielen Fronten erfolgreich
Obwohl der Kraftwerkbau ein grosser Treiber der volkswirtschaftlichen Entwicklung jener Zeit war, profitierte das einheimische Gewerbe anfänglich kaum davon, was zu einer geharnischten Resolution der Delegiertenversammlung des Bündner Gewerbeverbandes führte und anschliessend zu verschiedenen Besprechungen mit dem Kleinen Rat (heute Regierung) und den Investoren aus dem Unterland. Die Intervention war erfolgreich und führte zur sogenannten «Gewerbeschutzklausel» in allen Konzessionen der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Bei Konkurrenzfähigkeit in Qualität und Preis musste die Arbeitsvergebung an Unternehmungen der Konzessionsgemeinden und übrigen Bündner Firmen gegenüber den Unterländer Bewerbern erfolgen. Um Umgehungen zu verhindern, wurde in der Folge die Klausel permanent verschärft. In vielen weiteren Bereichen, sei es bei der Einführung von Gesamtarbeitsverträgen, ihrer Allgemeinverbindlichkeit, kollektiven Streitigkeiten (sprich: Streik), den Revisionen des kantonalen Steuergesetzes, der Ausdehnung des Fähigkeitsausweises im Gastgewerbe oder der Kompetenz der Gemeinden, im Gastgewerbe eine «gewerbepolitische-wirtschaftliche Bedürfnisklausel» einzuführen, wusste der Bündner Gewerbeverband, sich für seine Mitglieder und Sektionen einzusetzen. Verwehrt blieb ihm allerdings die Einführung eines obligatorischen Fähigkeitsausweises für das Wagner-, Sattler-, Schumacher- und Coiffeurgewerbe.
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel
Die lang anhaltende Wachstumsphase nach dem 2. Weltkrieg nährte die Hoffnung, lang anhaltende Einbrüche würden ausbleiben. Zwar boomte die Wirtschaft Anfang der Siebzigerjahre noch, doch die Überhitzung des Wirtschaftsmotors hatte eine hohe Teuerung zur Folge. Es kam zu unergiebiger Hektik, denn die Politik war im Irrtum, mit konjunkturpolitischen Massnahmen, über die der Schweizer Souverän abstimmen musste, erfolgreich Gegensteuer gegeben zu haben. Der BGV wehrte sich erfolglos an der Urne. Abgesehen davon, dass die Wirkungen solcher Massnahmen schon damals sehr umstritten waren, kamen sie eindeutig zu spät. Aber es prasselten nicht nur hausgemachte Probleme auf die Schweiz und Graubünden ein. Der Übergang zu flexiblen Wechselkursen war zwar langfristig richtig, verursachte aber eine deutliche Aufwertung des Schweizer Frankens, weil dieser schlicht unterbewertet war. Hinzu kam 1973 die durch den Jom-Kippur-Krieg ausgelöste Erdölkrise. Das Fazit in Graubünden: Die Bautätigkeit ging erheblich zurück, der Zuzug ausländischer Saisonarbeiter wurde begrenzt, im Tourismus wurden erste Anzeichen einer Stagnation festgestellt, der Detailhandel hatte seit längerer Zeit mit den grossen Einkaufszentren zu kämpfen, die mit der Krise einhergehende Abwanderung führte zu einem geringeren Konsum. Die Bündner Gewerblerinnen und Gewerbler waren gezwungen, erstmals seit vielen Jahren den Gürtel enger zu schnallen.