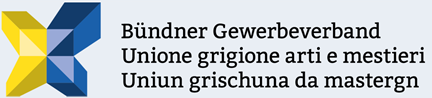Aussenansicht auf das Bauen in Graubünden
16.09.2025

Im Interview für das Magazin «Bauen Graubünden» wirft der ausgewiesene Bauexperte Peter Richner einen Blick auf das Bauen in unserem Kanton. Graubünden soll weiterhin auf seine hohe Architekturqualität setzen, innovativ bleiben und Bauprojekte frühzeitig gemeinsam planen, rät der ehemalige stellvertretende Direktor der Empa und Departementsleiter Ingenieurwissenschaften.
Peter Richner befasst sich seit über 20 Jahren mit Bauthemen. Er ist ein Pionier des nachhaltigen Bauens. Der abtretende Empa-Vizedirektor ist überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren in der Baubranche einiges bewegen und verändern wird. In Zukunft wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern noch wichtiger werden, ist er überzeugt.
Peter Richner, wie sind Sie als ausgebildeter Chemiker zum Bauen gekommen?
Durch Zufall. Ich kam über meine Arbeit bei der Empa zum Bauwesen, da ich mich mit der Korrosion an Gebäuden und Infrastrukturen beschäftigte. So rutschte ich eigentlich ungewollt ins Bauwesen hinein. Später übernahm ich das Departement Ingenieurwissenschaften, das sämtliche Bauabteilungen umfasst. Es ist ein ungewöhnlicher Karriereweg, aber er hat mir viel Freude bereitet.
Was fasziniert Sie am Bauen?
Wenn man sich näher damit beschäftigt, erkennt man, dass das Bauen einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft und Lebensqualität ist. Wir verbringen 80 bis 90 Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Auch wenn wir draussen sind, bewegen wir uns meist auf einer Verkehrsinfrastruktur, die ein Gebäude mit dem anderen verbindet. Jede Gesellschaft definiert sich in hohem Mass über ihre Gebäude – man denke an das alte Ägypten mit den Pyramiden oder den globalen Wettbewerb um das höchste Hochhaus. Kultur und Identität haben viel mit Bauen zu tun. Gebäude sind für Menschen zentral. Das hat mich immer fasziniert, da es dabei auch immer um gute Architektur geht.
Was ist für Sie gute Architektur?
Schon im ersten Jahrhundert vor Christus wurde gute Architektur mit Festigkeit, Nützlichkeit und Schönheit beschrieben. Diese drei Prinzipien gelten bis heute. Ein Gebäude muss Schutz bieten, Behaglichkeit ausstrahlen und als «schön» wahrgenommen werden. Man muss sich darin wohlfühlen. Es muss als Ganzes stimmen. Ein Beispiel: Die Raumakustik ist in vielen Restaurants schlecht, man kann sich kaum unterhalten. Obwohl Geselligkeit in einem Restaurant sehr wichtig ist. Warum das so ist, weiss ich nicht. Technisch wäre das jedenfalls leicht zu lösen.
Sie beobachten seit mehr als 20 Jahren das Bauwesen in der Schweiz. Wie nehmen Sie es in Graubünden wahr?
Die Bautätigkeit ist stark mit dem Tourismus verbunden, sprich Hotels, Zweitwohnungen und Bergbahnen. Das kommt der Baubranche im Kanton zugute. Die Landschaft wurde in Graubünden im Vergleich zu anderen Regionen des Alpenraums durch das Bauen nicht verschandelt. Die Baukultur hat sich in positiver Weise weiterentwickelt, das ist sehr wertvoll. Diese Weiterentwicklung der Baukultur zeichnet Graubünden aus. Hinzu kommt eine hohe Qualität der Architektur. Der Kanton hat überproportional viele Architekten mit Weltruf. Daneben ist auch die Verkehrsinfrastruktur baulich stark geprägt. Auch die Ingenieurkunst hat in Graubünden eine lange Tradition.
Wo sehen Sie Entwicklungsbedarf in Graubünden?
Auch in Graubünden wird das Thema nachhaltiges Bauen an Bedeutung gewinnen. Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft sind dabei wichtig. In Graubünden habe ich einige gute Beispiele dazu gesehen, etwa an der Green-Tech-Fachtagung, die letzthin von den Dachorganisationen Wirtschaft Graubünden organisiert wurde. Bisher sind es aber auch in Graubünden leider nur einzelne Projekte. Das nachhaltige Bauen muss mehr in die Breite. Hier sind vor allem die öffentlichen Bauherren und die grossen Investoren gefragt. Sanierungen und Umnutzungen werden einen wichtigen Beitrag leisten, denn wir können nicht alles neu bauen.
Sie haben die Umnutzung angesprochen. Dabei geht es auch um neue Prozesse und Techniken, die standardisiert werden müssen. Was kann die Empa dazu beitragen?
Bei der Empa begleiten wir verschiedene Projekte aus Graubünden. An der Nest-Plattform soll alles zusammenkommen. Das Ziel ist es, so zu planen, dass alles wieder zurückgebaut werden kann. Dies verursacht bei richtiger Planung kaum Mehrkosten. Man muss es einfach tun. Mit dem Nest möchten wir zeigen, dass Kreislaufwirtschaft praktisch umsetzbar ist. Umweltauswirkungen senken, Ressourcenverbrauch minimieren, Abfälle vermeiden, Produkte wiederverwenden – das ist unser Ziel. Kreislaufwirtschaft ist ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell, das statt auf linearen Verbrauch auf Wartung, Wiederverwendung, Aufarbeitung, Recycling und Kompostierung setzt.
Welche der gemachten Erfahrungen lassen sich konkret auf Bauprojekte übertragen?
Nest verfolgt auch in den Bereichen Ökologie und Soziales eine ganzheitliche Nachhaltigkeit. Wir haben in den letzten Jahren Lösungen entwickelt, die anwendbar sind. Gebäude sollten als temporäre Materiallager verstanden werden. Alle Materialien sollten wiederverwendbar sein – kein Schweissen, kein Verkleben mehr, sondern mechanische Verbindungen. Alles muss rückbaubar sein. Ich bin zwar nicht Befürworter von Regulierungen, aber Rückbaukonzepte für grössere Bauprojekte könnten dieser Art des Bauens etwas Schub verleihen. Das Interesse am Thema ist derzeit gross. Doch der Markt für gebrauchte Materialien ist noch klein. Das erschwert ihre Verfügbarkeit und macht das Finden teuer. Das ist derzeit eine grosse Herausforderung. Wichtig erscheint mir, dass durch die Wiederverwendung des Materials das Handwerk wieder an Wert gewinnt. Das Baugewerbe kann davon profitieren, weil Ausbau, Anpassung und Wiedereinbau Handwerkskunst erfordern. Wichtig ist dabei auch, dass jedes Gebäude ein gutes Inventar braucht. Das ist der Kern des zirkulären Bauens. Alles muss dokumentiert sein, damit man später weiss, welche Bauelemente wo verbaut wurden. Hier hilft die Digitalisierung.
Welche Materialien haben am meisten Potenzial für ein solches Bauen?
Der Lebenszyklus eines Gebäudes beginnt mit dem Bau und endet mit dem Rückbau – derzeit nach rund 80 Jahren. Doch wer weiss schon, was in 50 Jahren ist? So gesehen haben alle Materialien Potenzial.
Bedeutet nachhaltiges Bauen automatisch höhere Kosten?
Nein, über den ganzen Zyklus ist es nicht teurer. Die Kosten sind anders verteilt, der Planungsaufwand ist etwas grösser, der Materialaufwand kleiner.
In der Praxis sind solche Bauformen selten, warum?
Den grössten Einfluss auf das Bauvorhaben haben die Bauherren. Wenn sie nachhaltiges Bauen wollen, lässt es sich umsetzen. Der Rückbau muss ein zentrales Thema für künftige Planer sein. Man könnte als Bauherr zum Beispiel vorgeben, dass zehn Prozent der Materialien aus Rückbauten stammen müssen. Derzeit wird viel Material minderwertig wiederverwendet. Das müssen wir verbessern. Es gibt aber auch gute Beispiele, die Mühle Grüsch ist ein Paradebeispiel. Dort haben von Anfang an alle Parteien miteinander gesprochen und gemeinsam den besten Weg gesucht.
Welche weltweiten Trends prägen das Bauen zurzeit?
Mehrere Trends prägen die globale Baubranche. Digitalisierung, nachhaltiges und ökologisches Bauen, Modularisierung und Automatisierung. Aber auch industrielle Fertigung von Bauten oder Teilen davon. Was sich wie durchsetzen wird, ist schwierig vorauszusagen. Auch Robotik auf der Baustelle wird diskutiert, wobei ich skeptisch bin, ob sich dies auf den im Vergleich zu Fabriken «chaotischen» Baustellen bewähren wird. Ich halte Exoskelette für realistischer. Sie helfen Arbeitern beim Tragen schwerer Lasten. In militärischen Anwendungen gibt es sie bereits. Bei der Digitalisierung werden mehr Daten vor Ort erzeugt und wiedergeben, wohl bald auch durch Datenbrillen, welche alles Einmessen. In der Schweiz hat auch die Modularisierung viel Potenzial. Im Ausland wird teilweise viel mehr mit Fertigelementen bis hin zu Fertighäusern gebaut.
Welche Innovationen werden das Bauen verändern?
Das Bauen der Zukunft wird durch digitale Technologien, nachhaltige Konzepte und industrielle Fertigung geprägt sein. Dies führt zu effizienteren, umweltfreundlicheren und intelligenteren Gebäuden. Ziel ist es, Bauen mit negativer CO₂-Bilanz zu ermöglichen. Neue Materialien müssen entwickelt werden, um CO₂ zu senken, insbesondere im Beton. Ich bin überzeugt, dass wir bald Beton mit hoher CO₂-Speicherung produzieren können.
Der Beton soll also das Klima retten?
Ja, Beton kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Er ist das am meisten von Menschen produzierte Material. Es gibt heute mehr menschengemachtes Material als trockene Biomasse oder organische Substanzen wie Holz. Die Hälfte davon ist Beton. Wenn Beton und Gebäude zu CO₂-Lagerstätten werden können, kann sich dies auch auf den Preis für das Bauen positiv zeigen.
Welche Zukunft wird der Holzbau haben?
Der Holzbau hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren stark entwickelt und einen enormen Aufschwung erlebt. Früher war es, pauschal ausgedrückt, einfach das klassische Chalet, das aus Holz gebaut wurde. Dann kamen innovative Holzbauer, die den Wandel vorangetrieben haben. Darum sehen moderne Holzhäuser heute anders aus. Auch die Prozesse wurden angepasst. Der Holzbau ist der Bereich, der die Prozesse heute am meisten automatisiert, sprich industrialisiert hat. Holz ist zudem CO₂-neutral und benötigt in der Herstellung wenig Energie.
Regulierungen gelten auch im Bauwesen als Innovationsbremse. Was sagen Sie dazu?
Es ist ein ewiger Kampf, das ist mir bewusst. Regulierungen, wie wir sie heute haben und wir sie alle kennen, ist der falsche Weg. Wir haben zu viele Detailregulierungen und Normen beim Bauen. Wir sollten nicht den Weg regulieren, sondern das Ziel. Ein Beispiel: Ein Gebäude muss erdbebensicher sein. Oder ein Gebäude darf nur eine bestimmte Energiemenge verbrauchen. Wie das Ziel erreicht wird, sollte den Bauherren und Planern überlassen sein. Andere einfachere Regulierungen sind gefragt, als viele Detailvorgaben, wie dies heute der Fall ist.
Viele junge Menschen können sich ein Eigenheim nicht mehr leisten. Wie lässt sich günstiger bauen?
Der Bodenpreis wird auch künftig nur einen Weg haben, nämlich nach oben. Unbestritten ist, dass auch die Baukosten stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Diese werden auch nicht gross zurückgehen. Wo man ansetzen kann, ist beim Planungsprozess. Prozesse zu vereinfachen und frühzeitig alle ins Boot zu holen, das kann helfen, Kosten zu sparen. Wie bei der Kreislaufwirtschaft gilt, dass alle Beteiligten von Anfang an dabei sein müssen. Gute Planung spart Geld. Vom Bauen her planen, heisst die Devise. Man sollte bei jeder Position hinterfragen, ob sie nötig ist. Es lassen sich fast immer Abstriche machen, wenn man will. Es braucht in Einfamilienhäusern keinen Trittschallschutz. Das ist nur ein Beispiel, es gibt viele weitere. Darum noch einmal: Die besten Projekte sind die, bei denen von Anfang an alle Beteiligten gemeinsam geplant haben.
Kommen wir zur letzten Frage: Welche Chancen sollte die Baubranche im Kanton Graubünden künftig nutzen?
Graubünden sollte weiterhin auf seine hohe Architekturqualität setzen und die kurzen Wege im Kanton konsequent nutzen, um gemeinsam Bauprojekte zu planen und umzusetzen. Durch gute Kommunikation lassen sich mit Sicherheit ganzheitliche Lösungen erzielen. Holz und Beton, die beiden Hauptbaumaterialien, haben im Kanton Graubünden definitiv eine Zukunft. Aber Bauen lebt auch von der Vielfalt, und die braucht verschiedene Materialien und Wege. Wenn wir uns beim Bauen über die Zukunft Gedanken machen, dann kommt es gut. Davon bin ich überzeugt.
Peter Richner und die EMPA
Der 65-jährige Peter Richner hat an der ETH Zürich Chemie studiert und anschliessend doktoriert. Nach verschiedenen Funktionen an der Empa übernahm er 2002 die Leitung des Departements Ingenieurwissenschaften. Von 2012 bis März 2025 war er stellvertretender Direktor, verantwortlich für die Forschungsstrategie im Energiebereich und leitete das Departement Ingenieurwissenschaften. Darüber hinaus fungiert Richner als Verantwortlicher des Nest eine Forschungs- und Innovationsplattform, welche die Entwicklung und Validierung neuer Lösungen für Gebäude unter realen Bedingungen fördert, und wo der Wissens- und Technologietransfer im Vordergrund steht. Die Empa ist das interdisziplinäre Forschungsinstitut des ETH-Bereichs für Materialwissenschaften und Technologie. Als Brücke zwischen Forschung und Praxis erarbeitet sie zukunftsweisende Lösungen für die vorrangigen Herausforderungen von Industrie und Gesellschaft, so auch im Bauwesen.
Nachhaltiger Beton aus Graubünden
Der Bausektor steht zunehmend in der Verantwortung, nachhaltiger zu agieren. Beton ist dabei ein zentraler Baustoff – aber auch ein CO₂-Treiber. Neue Entwicklungen machen es heute möglich, Beton deutlich klimafreundlicher herzustellen. Auch im Kanton Graubünden sind zahlreiche nachhaltige Betonlösungen erhältlich. Ein Überblick:
- CO₂-reduzierte und ressourcenschonende Zemente: In Graubünden sind Betone erhältlich, die Zemente mit reduziertem Klinkeranteil enthalten. Diese nachhaltigen Betonsorten senken den CO₂-Ausstoss spürbar und sparen natürliche Ressourcen. Der Ersatz von Klinker durch alternative Materialien wie hochwertig aufbereitetes Mischgranulat, gebrannter Schiefer, Kalksteinmehl oder Hüttensand reduziert den ökologischen Fussabdruck erheblich.
- Recycling-Beton – im Kreislauf gebaut: Betone mit rezyklierten Gesteinskörnungen (zum Beispiel aus Beton- und Mischabbruch) ersetzen heute in vielen Anwendungen den Einsatz von natürli-chen Kies- und Sandressourcen. Dank moderner Aufbereitungstechniken können grosse Mengen an Recyclingmaterial im Beton wiederverwendet werden – bevorzugt im Hochbau, auch als Sichtbeton. Dies fördert die Kreislaufwirtschaft, spart Deponieraum und reduziert Transportwege.
- Beton mit gebundenem CO₂: Ein innovativer Ansatz ist der Ein-satz von karbonatisiertem Betongranulat. Dabei wird CO₂ gezielt im Recyclingmaterial gebunden. Dieser Beton speichert das CO₂ dauerhaft im Material und trägt aktiv zur CO₂-Speicherung bei.
- Beton mit Pflanzenkohle – klimaneutral bauen: Noch einen Schritt weiter geht Beton mit Pflanzenkohle-Zusatz. Diese Kohle wird aus Biomasse gewonnen und speichert CO₂ dauerhaft. In Kombination mit anderen Massnahmen können solche Betone eine Netto-Null-CO₂-Bilanz erreichen – also komplett klimaneutral sein.
Die Auswahl eines nachhaltigen Betons ist ein erster Schritt – entscheidend ist aber die korrekte Ausschreibung. Je nach Anwendungszweck müssen die geforderten Eigenschaften des Betons klar definiert sein. So kann das passende nachhaltige Produkt eingesetzt werden – ohne Kompromisse bei Qualität oder Langlebigkeit.