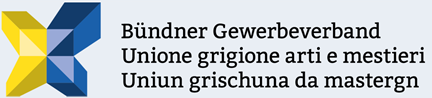«Beteiligung muss man wollen»
18.08.2025

Der Einbezug von Mitarbeitenden gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies bedeutet nicht, dass Führungspersonen oder Unternehmer/innen ihre Mitarbeitenden in jede Entscheidung einbinden müssen. «Es können nicht immer alle mitreden – klare Rollen und Aufgaben bleiben auch heute entscheidend, um effektiv und effizient zu arbeiten», betont Nina Prochazka, die seit 20 Jahren als Beraterin im Bereich partizipativer Führung tätig ist.
Viele Unternehmen hätten bei der aktiven Mitgestaltung durch Mitarbeitende noch erhebliches Potenzial, sagt Nina Prochazka im Gespräch mit dem «Bündner Gewerbe». Prochazka ist Beraterin für Organisationsentwicklung und Führungscoach bei GoBeyond, einem auf New Work, Agilität und Transformation spezialisierten Beratungsnetzwerk.
Nina Prochazka, welche Unterschiede und Möglichkeiten des Einbezugs gibt es?
Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen Mitarbeitende einbezogen werden können. Auf der strategischen Ebene geht es darum, Mitarbeitende in Zukunftsfragen einzubinden. Das kann beispielsweise im Rahmen von Strategieprozessen geschehen, etwa mit Methoden wie Zukunftswerkstätten oder Innovationszirkeln. Auf der operativen Ebene steht die gemeinsame Verbesserung von Prozessen im Vordergrund. Dazu eignen sich Formate wie ein strukturiertes Ideenmanagement, Hackathons oder Projektbeiräte. Ein bekanntes Beispiel ist die Bündner Kantonalbank, die einmal einen Jugendbeirat eingerichtet hatte. Dieser ermöglichte jungen Mitarbeitenden und Kund/innen, aktiv an der Gestaltung von Angeboten und sogar an der strategischen Ausrichtung der Bank mitzuwirken. Schließlich gibt es noch die Ebene des Arbeitsalltags. Hier geht es um Beteiligung im Kleinen, etwa bei der Gestaltung von Arbeitszeiten, beim Einsatz von Tools oder bei der Definition von Teamregeln.
Welche positiven Veränderungen haben Sie erlebt, wenn Mitarbeitende aktiv mitgestalten durften?
Ich habe immer wieder erlebt, dass Teams durch Beteiligung förmlich aufblühen. Die Stimmung verbessert sich deutlich, die Eigenverantwortung steigt, und – vielleicht am wichtigsten – es entstehen plötzlich Lösungen, die vorher undenkbar waren. Beteiligung entfacht Energie, sie bringt eine neue Dynamik ins Unternehmen und macht es lebendig.
Beteiligen heißt auch Verantwortung übernehmen. Man hört heute aber oft, dass Mitarbeitende weniger Verantwortung tragen möchten und gleichzeitig mehr einbezogen werden wollen. Wie passt das zusammen?
Das ist tatsächlich der berühmte «Elefant im Raum“. Viele Menschen wünschen sich Mitsprache, scheuen aber gleichzeitig die Verantwortung. Meine Erfahrung ist, dass sich dieses Spannungsfeld auflösen lässt, wenn Beteiligung gut gestaltet ist. Das bedeutet: Es braucht klare Rollen, Anerkennung und psychologische Sicherheit. Dann wächst auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ganz entscheidend ist: Beteiligung darf kein Sparmodell sein – also nicht die Auslagerung von Aufgaben, weil jemand seine Arbeit nicht gut macht. Es muss ein echtes Beziehungskonzept sein. Dahinter stecken auch psychologische und kulturelle Faktoren. Verantwortung bedeutet immer auch Risiko, und viele Menschen haben Angst, bei Fehlern zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wenn Fehler oder auch vermeintlich schlechte“ Ideen sanktioniert werden, anstatt sie als Lernchance zu betrachten, sinkt die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen. Hinzu kommt, dass Verantwortung in dynamischen, oft überfordernden Umfeldern leicht als zusätzliche Belastung empfunden wird. Mitarbeitende haben dann den Eindruck, ihre Vorgesetzten wollten sie mit weiteren Aufgaben „missbrauchen“. Und schließlich wollen viele zwar mitgestalten, aber nicht unbedingt allein entscheiden oder haften. Das ist meiner Meinung nach völlig legitim.
Was müssen Unternehmen beachten, wenn sie Mitarbeitende einbeziehen möchten?
Beteiligung braucht Struktur und Klarheit. Es muss transparent sein, wer, wann und wie einbezogen wird. Ebenso wichtig ist eine ehrliche Kommunikation darüber, welchem Zweck die Beteiligung dient. Denn Beteiligung ohne echte Wirkung ist nicht nur frustrierend, sondern sogar kontraproduktiv. Damit Beteiligung gelingt, muss sie gut durchdacht sein und am Anfang bewusst eingeübt werden. Beteiligung ist kein reines Instrument, sondern ein Prozess der Kulturarbeit.
Auf was sollen Führungskräfte achten, wenn sie Mitarbeitende einbeziehen?
Führung heute muss vor allem Raum geben, anstatt nur zu steuern. Sie muss zuhören können, anstatt nur Botschaften zu senden. Und sie bedeutet, Menschen stark zu machen, anstatt lediglich Prozesse zu managen.
Welche Kompetenzen brauchen Mitarbeitende, um aktiv eingebunden zu werden?
Mitarbeitende brauchen Selbstreflexion, Mut zur Mitgestaltung und auch ein gewisses Maß an Kommunikationsfähigkeit. Diese Fähigkeiten helfen ihnen, sich einzubringen und die Chancen, die Beteiligung bietet, aktiv zu nutzen.
Wo liegen die typischen Stolpersteine beim Einbezug?
Beteiligung kostet Zeit, und das ist oft eine Hürde. Deshalb muss sie alltagstauglich sein. Kurze, schlanke Formate helfen dabei. Hier bietet die Digitalisierung viele Möglichkeiten, weil sie Beteiligung vereinfacht und beschleunigt. Wichtig ist außerdem, dass Beteiligung in einem klaren Kommunikationsprozess stattfindet, mit Feedbackschleifen. Vertrauen und eine gelebte Fehlerkultur sind entscheidend. Nicht jeder Vorschlag ist gut, aber gute Vorschläge können aus allen Hierarchiestufen kommen – und das muss anerkannt werden.
Was sind die Grenzen der Mitbestimmung?
Natürlich kann nicht jede Entscheidung basisdemokratisch getroffen werden. Aber Mitsprache ist fast immer möglich, auch wenn die letztendliche Entscheidung bei der Führung bleibt.
Was sollte man unbedingt vermeiden?
Beteiligung darf kein Feigenblatt sein. Sie darf nicht dazu dienen, Verantwortung einfach abzuschieben. Ebenso frustrierend ist Beteiligung ohne Anerkennung oder ohne Rückmeldung. All das untergräbt Vertrauen und zerstört die Motivation.
Wie gelingt es, auch skeptische oder zurückhaltende Mitarbeitende mitzunehmen?
Indem man sie einlädt, statt sie zu zwingen. Wichtig sind kleine, aber stetige Schritte, und es ist entscheidend, Erfolge sichtbar zu machen. So entsteht Vertrauen. Viele Menschen werden erst dann aktiv, wenn sie spüren: Mein Beitrag zählt tatsächlich.
Welche Methoden und Tools setzen Sie ein, um Unternehmen und Führungskräfte beim Einbezug von Mitarbeitenden zu unterstützen?
Sehr bewährt haben sich Ideenmanagement, Zukunftswerkstätten und Open-Space-Formate. Auch digitale Feedbacktools oder Instrumente wie Mentimeter für Live-Stimmungsbilder sind äußerst hilfreich.
Welche Formate eignen sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)?
Für KMU sind einfache, leicht umsetzbare Formate ideal: zum Beispiel kurze Sitznachbar-Austausche nach dem 1–2–4-Prinzip, Mini-Workshops, Blitzlicht-Fragen oder Feedbackrunden mit Karten oder digitalen Apps.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Ein KMU führte ein wöchentliches „Team-Check-in“ ein: 15 Minuten, in denen jede und jeder sagen konnte, was gut läuft, was stört und was gebraucht wird. Die Wirkung war beeindruckend: mehr Vertrauen, bessere Zusammenarbeit – und überraschend viele Ideen.
Was ist bei der Einführung einer neuen Methode oder eines neuen Beteiligungsprozesses besonders wichtig?
Man sollte mit einem klaren Rahmen starten und zunächst eine Pilotphase durchführen. Feedbackschleifen sind unverzichtbar, ebenso eine Begleitung durch Moderation oder Coaching.
Was raten Sie KMU, die gerade erst beginnen, ihre Mitarbeitenden stärker einzubeziehen?
Starten Sie klein, aber ehrlich. Beteiligung muss nicht perfekt sein, aber sie muss echt sein. Überlegen Sie sich: Warum wollen Sie Beteiligung, was möchten Sie damit erreichen? Beginnen Sie mit einem Bereich, in dem Beteiligung sofort spürbar wird – und bauen Sie von dort aus weiter.