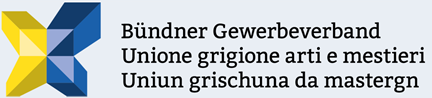Nachhaltiges Bauen ist kein Lippenbekenntnis
04.08.2025

Mit dem Erweiterungsneubau der Mühle Grüsch setzen Bauherrin und Architekten neue Massstäbe für nachhaltiges Bauen in Graubünden. Hinter dem Projekt steht die 2021 von der Zindel AG und der Schumacher Beteiligungen AG gegründete Gutgrün AG. Michael Zindel, Verwaltungsrat der Gutgrün AG, und Markus Wolf, CEO bei Ritter Schumacher, sprechen im Interwiew für das Magazin «Bauen Graubüden» über das nachhaltige Bauprojekt im Prättigau.
Erklären Sie kurz, was das Besondere am Bauprojekt Mühle Grüsch ist?
Michael Zindel: Das Bauprojekt Mühle Grüsch verwandelt die ehemalige Getreidemühle direkt am Bahnhof Grüsch in ein lebendiges Wohnquartier. Aus der alten Industriebrache entsteht ein nachhaltiges Wohnensemble – energetisch modern, sozial sinnvoll und ökologisch innovativ durch Kreislaufwirtschaft und regenerative Materialien.
Was ist Ihre Rolle als Investor?
Michael Zindel: Ich bin Teilhaber und Verwaltungsrat der GUTGRÜN AG, einem Gefäss, das sich ganz auf die Entwicklung nachhaltiger Immobilien konzentriert. Bei der Mühle Grüsch haben wir das Potenzial des Projekts erkannt, vor allem in Verbindung mit echter Nachhaltigkeit. Als Investor sehe ich meine Rolle darin, mutige Impulse zu geben, langfristig zu denken und den Rahmen zu schaffen, in dem Architektur und Innovation sich frei entfalten können.
Markus Wolf: Und was ist Ihre Aufgabe?
Markus Wolf: Ritter Schumacher war als Architekt für die Entwicklung, Planung und Umsetzung des Projekts verantwortlich. Mit unserem eigenen interdisziplinären Team – bestehend aus Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren sowie Fachleuten für Nachhaltigkeit – haben wir die geforderten Lösungen entwickelt und die zentralen Konzepte erarbeitet, die das Projekt heute prägen.
Wie sind Sie zum Projekt gestossen?
Michael Zindel: Ich arbeite schon seit 25 Jahren mit Michael Schumacher zusammen. Wir haben gemeinsam vor über 15 Jahren das erste zertifizierte Minergie-P-eco-Mehrfamilienhaus in Graubünden erstellt. Als Michael die Idee geäussert hat, ein eigenes Gefäss für nachhaltige Immobilien zu gründen, habe ich diese begeistert aufgenommen, und wir haben gemeinsam 2021 die GUTGRÜN AG gegründet. GUTGRÜN verfolgt das Ziel, Gebäude zu entwickeln, die gut für Mensch, Umwelt und langfristig auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Damit das gelingt, arbeitet GUTGRÜN mit klaren Vorgaben und überprüft während der ganzen Projektzeit zum Beispiel mit einem eigenen «Nachhaltigkeitskompass», ob die Ziele eingehalten werden. Schnell waren wir uns auch einig, dass die Mühle Grüsch sich ideal als erstes Leuchtturm-Projekt eignet.
Wo gab es die grössten Herausforderungen bei diesem doch etwas speziellen Bauprojekt?
Markus Wolf: Erst die Steine, besser gesagt der Beton auf unserem Weg, haben es möglich gemacht, die Mühle so zu bauen, wie sie heute dasteht. Wir hörten oft: «Das geht so nicht», «Ihr könnt das so doch nicht machen» oder «Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schliessen sich aus». Doch wir standen zu unserer Überzeugung und haben die Idee konsequent weiterverfolgt und die Probleme ausdiskutiert, bis wir die Lösung hatten. Auch auf technischer Ebene gab es Herausforderungen, etwa bei der Entwicklung und Verarbeitung des neuen Betons oder bei den komplexen Details der schweizweit einzigartigen Photovoltaik-Fassade. Dank der Zusammenarbeit im Allianzmodell hatten wir früh Partner an Bord, die an unsere Idee glaubten und mit ihrem Fachwissen massgeblich zur Umsetzung beigetragen haben.
Wo waren Sie positiv überrascht?
Markus Wolf: Positiv überrascht hat uns, wie schnell im Allianzmodell eine Kultur der Lösungsorientierung entstanden ist, und das auch von Seiten der Behörden. Die Gemeinde und die Feuerpolizei Graubünden haben gezeigt, dass man im konstruktiven Dialog zu professionellen und tragfähigen Lösungen kommt. Die Resonanz von aussen – sei es von Fachleuten oder der Bevölkerung – bestätigt uns darin, dass das Projekt einen Nerv trifft.
Haben Sie weitere ähnliche Projekte in der Pipeline?
Michael Zindel: Ja, wir entwickeln aktuell mehrere Projekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, einer starken architektonischen Haltung und klarer Wirtschaftlichkeit. Die Erfahrungen aus der Mühle Grüsch fliessen direkt in neue Vorhaben ein. Wir profitieren von den Erkenntnissen aus dem Prozess und entwickeln unser Wissen gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich weiter.
Was ist bei der Mühle Grüsch nachhaltig?
Michael Zindel: Das Projekt wurde nach dem DGNB-Modell mit dem Anspruch an eine ganzheitliche, also holistische Nachhaltigkeit entwickelt. Diese umfasst ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.
Markus Wolf: Wir arbeiten mit regionalen Materialien und Unternehmern, setzen auf einen hohen Recyclinganteil, eine CO₂-optimierte Statik und erneuerbare Energien. Ergänzt wird das durch ein Mobilitätskonzept und eine soziale Durchmischung – direkt am Bahnhof, mit bezahlbarem Wohnraum für unterschiedliche Lebensmodelle.
Schauen wir genau hin. Einige Stichworte: Energie?
Michael Zindel: Das Energiekonzept der Mühle Grüsch setzt konsequent auf erneuerbare Quellen. Strom wird direkt am Gebäude durch eine integrierte Photovoltaik-Fassade sowie eine zusätzliche Dachanlage zur Eigenversorgung produziert. Die Wärme liefert eine zentrale Wärmepumpe. Für ein angenehmes Raumklima und minimale Energieverluste sorgt eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das Gebäude wird nach dem Standard Minergie-P zertifiziert.
Wie wurden CO₂-Emissionen minimiert und wie sieht es mit den grauen Emissionen aus (Scope 3)?
Markus Wolf: Wenn man die CO₂-Emissionen insgesamt reduzieren möchte, muss die zeitliche Betrachtung auf den gesamten Lebenszyklus ausgeweitet werden. Das heisst, die Emissionen aus der Herstellung und dem Transport der Baumaterialien, häufig auch als graue Energie bezeichnet, müssen ebenso berücksichtigt werden wie die Emissionen während des Betriebs und im Rückbau. Wir haben die Tragkonstruktion, die Grundrisse, die Installationen und selbst das Design konsequent hinterfragt und weiterentwickelt. Es ging darum, die Grenzbereiche auszuloten. Was ist möglich, was nicht? Dabei entstand auch eine neue Ästhetik. Dank Simulationen und Tests konnten wir über das hinausgehen, was bisher üblich war und den CO₂-Fussabdruck deutlich senken. Durch die konsequente Überproduktion von Energie am Standort können über die Zeit die CO₂-Emissionen kompensiert werden. Digitale Planung und eine lückenlose Materialdokumentation ermöglichen in der fernen Zukunft einen nachhaltigen Rückbau.
Da es sich teilweise um einen Ersatzneubau handelt, wie sieht es mit der Kreislaufwirtschaft aus?
Markus Wolf: Bis zu 95 Prozent der Materialien wurden sortenrein getrennt und wiederverwendet, ein Grossteil davon direkt im Neubau, etwa als rezyklierter Beton. Gemeinsam mit dem Baumeister, dem Betonwerk, dem Zementhersteller und dem Ingenieur haben wir einen Beton entwickelt, der sich nicht blind an die Norm hält, sondern exakt auf die statischen Anforderungen abgestimmt ist – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Diese Bemühungen wurden mit dem ersten DGNB-Rückbauzertifikat der Schweiz honoriert.
Gibt es weitere Aspekte von Nachhaltigkeit beim Projekt?
Michael Zindel: Nachhaltigkeit zeigt sich bei der Mühle Grüsch in vielen Ebenen. Die zentrale Lage am Bahnhof fördert den ÖV, der Wohnungsmix sorgt für soziale Durchmischung und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern stärkt die lokale Wertschöpfung. Alle Materialien sind ECO-zertifiziert. Es werden keine Schadstoffe verbaut. Das Innenraumklima wird geprüft, um gesundes Wohnen zu garantieren. Digitale Planung und lückenlose Materialdokumentation machen das Gebäude im Betrieb, in der Umnutzung und im Rückbau zukunftsfähig.
Wie sieht es finanziell aus? Bedeutet nachhaltiges Bauen eine kleinere Rendite?
Michael Zindel: Nachhaltiges Bauen ist zunächst teurer. Ein Beispiel ist die PV-Fassade. Langfristig rechnet es sich aber. Die Anlage liefert Ertrag, die Betriebskosten sind tiefer, der Werterhalt des Gebäudes höher. Und die Nachfrage nach smartem, gesundem und nachhaltigem Wohnraum steigt, besonders dann, wenn die Nutzer eine echte Wahl haben.
Markus Wolf: Dank kluger Planung, optimierter Prozesse und der engen Zusammenarbeit im Allianzmodell konnten wir viele Kosten gezielt steuern. Nachhaltigkeit bedeutet also nicht zwingend eine kleinere Rendite. Im Gegenteil. Sie schafft Stabilität, Zukunftssicherheit und ist darüber hinaus sinnstiftend für alle Beteiligten.
Wie beurteilen Sie die derzeitigen regulatorischen Rahmenbedingungen für solch innovative Bauprojekte?
Markus Wolf: Gehindert haben uns weniger der Wille, sondern vielmehr starre Regulierungen und normgetriebene Prozesse. Wenn man neue Wege gehen will, wie etwa bei der PV-Fassade oder beim Recyclingbeton, stösst man schnell an Grenzen von Normen, Zulassungen oder Formularlogik. Auch die Nachweispflicht bei Zertifizierungen ist aufwendig und bindet viel Zeit und Ressourcen.
Michael Zindel: Was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, die Innovation nicht nur zulassen, sondern aktiv fördern – vor allem, wenn sie nachweislich nachhaltiger und sinnvoller ist.
Können Sie dies näher ausführen?
Markus Wolf: In der klassischen Baupraxis werden Projekte oft sequenziell abgewickelt. Zuerst planen, dann ausschreiben, dann ausführen. Dabei gehen Know-how, Zeit und Vertrauen verloren. Im Allianzmodell setzen wir bewusst auf das Gegenteil: Wir bringen die richtigen Leute, sprich Planer, Unternehmer und Bauherr von Anfang an zusammen und entwickeln das Projekt gemeinsam. Wichtig ist dabei, dass diese Allianz nicht bei jedem funktioniert. Es braucht Partner, die mitdenken, Verantwortung übernehmen und nicht nur auf den Preis schauen. Vertrauen, Offenheit und gemeinsame Lösungsorientierung sind zentrale Voraussetzungen. In Grüsch hat das hervorragend funktioniert. Die Zusammenarbeit war geprägt von gegenseitigem Respekt, direktem Austausch und echtem Teamgeist – ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Qualität und Effizienz des Projekts.
Wie ändert sich die Rolle der Planer mit dem Allianzmodell?
Markus Wolf: Im Allianzmodell ändert sich die Rolle der Planer grundlegend. Sie arbeiten nicht mehr isoliert vor, sondern entwickeln Lösungen im direkten Austausch mit den Unternehmern und der Bauherrschaft. Der Planer wird zum Sparringspartner, Moderator und Mitgestalter. Entscheidungen entstehen gemeinsam und mit Blick auf das grosse Ganze, nicht nur auf den eigenen Fachbereich. Das erhöht die Qualität, reduziert Konflikte und führt zu realistischeren, effizienteren Lösungen.
Wie ändert sich die Rolle der Bauherren und Investoren?
Michael Zindel: Statt Kontrolle aus Distanz entsteht im Allianzmodell eine echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit direktem Zugang zu den Fachleuten, sehr kurzen Entscheidungswegen und einem gemeinsamen Ziel. Das schafft Vertrauen, erhöht die Qualität und führt zu Entscheidungen, die wirtschaftlich sinnvoll und inhaltlich langfristig tragfähig sind.
Und die Rolle der ausführenden Gewerke?
Michael Zindel: Ihre Rolle verändert sich damit von einem reinen Auftragsempfänger zum aktiven Mitgestalter. Sie übernehmen Verantwortung, denken in einer sehr frühen Phase schon mit und suchen gemeinsam mit Planern und Bauherrschaft nach der optimalen Lösung. Das fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern ermöglicht mit weniger Reibungsverlusten und mehr Verständnis für das Gesamtprojekt eine effizientere und qualitativ hochwertigere Abwicklung des Auftrags.
Wie wurde das Ganze vertraglich geregelt? Wann fanden die Abnahme und Kostenkontrolle statt?
Markus Wolf: Zum Erstaunen vieler haben wir am Ende mit unterschiedlichen Abrechnungsarten ganz gewöhnliche Werkverträge eingesetzt. Einige Gewerke wurden pauschal abgerechnet, andere nach Aufwand. Entscheidend war, dass wir jeweils die passende Vertragsform gemeinsam diskutierten und pro Gewerk pragmatisch umsetzten. So entstand eine flexible, aber klare Grundlage, die auf Vertrauen und Zusammenarbeit statt auf Misstrauen basierte.
Wie wurden Entscheidungen getroffen?
Michael Zindel: Entscheidungen wurden schnell, direkt und lösungsorientiert im kleinen, klar definierten Kernteam getroffen.
Was nehmen Sie an Erfahrungen mit?
Michael Zindel: Die wichtigste Erfahrung ist, dass echte Projektenergie entsteht, wenn die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am Tisch sitzen. Die Allianz hat gezeigt, dass Vertrauen, Offenheit und ein gemeinsames Ziel mehr bewirken als jedes Reglement.
Markus Wolf: Wir nehmen mit, dass komplexe Projekte einfacher werden, wenn man früh gemeinsam denkt, und dass echte Nachhaltigkeit nur gelingt, wenn alle sie mittragen. Diese Erfahrung stärkt uns fachlich, menschlich und organisatorisch für zukünftige Projekte. Eine Herausforderung war sicher, neue Denk- und Arbeitsweisen bei allen Beteiligten zu verankern – weg von klassischen Rollenbildern, hin zu echter Zusammenarbeit. Das braucht Zeit, Vertrauen und manchmal auch Geduld.
Was würden Sie anders machen?
Markus Wolf: Was wir anders machen würden? Eine gute Frage. Gewisse Prozesse früher standardisieren, zum Beispiel im Umgang mit digitalen Planungsdaten oder bei der Entscheidung, welche Vertragsform für welches Gewerk am besten passt.
Wann eignet sich das Modell nicht?
Michael Zindel: Wir sehen zum Beispiel nicht, wie die öffentliche Hand einen solchen Prozess umsetzen könnte. In unserem Fall hatten wir das Glück, direkt auf unsere Wunschpartner zuzugehen und sie gezielt ins Projekt zu holen. Wenn wir bei einem Punkt nicht einig waren, konnten wir sofort reagieren und gemeinsam eine neue Lösung finden.
Markus Wolf: Das Allianzmodell funktioniert nur, wenn Vertrauen vorhanden ist und alle Beteiligten bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es scheitert, wenn einzelne Partner rein preisgetrieben denken, nur den eigenen Vorteil im Blick haben oder wenn der Besteller keine mutigen Entscheidungen treffen kann. Ohne Haltung, Offenheit und Entscheidungsfähigkeit ist echte Zusammenarbeit nicht möglich.