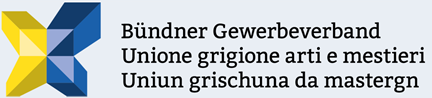Rechtlich und planerisch gut vorbereitet
14.10.2025

Bauen ist komplexer geworden. Dies merken Unternehmen, die erstmals oder längere Zeit nicht mehr gebaut haben und nun ein Projekt realisieren wollen. Rechtsanwalt Reto Annen, seit 2009 Sekretär des Hauseigentümerverbands HEV Chur Regio, gibt Unternehmer/innen einen Überblick über die wichtigsten Punkte, die sie von der Idee bis zur Umsetzung von Bauprojekten beachten sollten.
Es gibt Unterschiede, ob man als Privatperson oder mit dem Unternehmen baut, und ob es sich um eine Wohnliegenschaft oder eine Gewerbeliegenschaft handelt. Allen Bauprojekten ist gemein, dass Bauen nicht mit dem Aushub auf der Baustelle beginnt, sondern in der Planungsphase. Die Qualität der Planung ist entscheidend für Funktionalität, Rechtskonformität, Kostenkontrolle und Wirtschaftlichkeit.
Funktional und zonenkonform
Im gewerblichen Bereich spielen nicht nur architektonische Fragen eine Rolle, sondern auch Energieeffizienz, Erweiterbarkeit, Erschliessung und Betriebskosten. «Ein häufig unterschätzter Punkt ist die frühzeitige Integration von Fachplanern für Haustechnik, IT-Infrastruktur, Brandschutz oder Nachhaltigkeit», sagt Reto Annen, Rechtsanwalt und Notar bei der Kanzlei am Kornplatz in Chur. Auch Anforderungen wie Lärmschutz, Parkplatznachweis oder behindertengerechtes Bauen sollten bereits zu Beginn berücksichtigt werden, damit sie später keine Hürden darstellen.
«Entscheidend», sagt Annen, ist, «welche Nutzungen auf einem Grundstück zulässig sind». In Graubünden unterscheidet die Gesetzgebung zwischen mehreren Zonen. Wohnzonen sind primär für Wohnzwecke bestimmt, während Arbeitszonen für gewerbliche und industrielle Nutzungen sowie Dienstleistungen vorgesehen sind. Ausnahmen zur Wohnnutzung in Gewerbezonen gelten grundsätzlich nur für Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber oder betriebseigenes Personal; diesbezüglich gibt es kommunale Unterschiede. Viele Unternehmer sind überrascht, wenn sie erfahren, dass es in einer Arbeitszone betreffend Erstellung von Mietwohnungen Einschränkungen gibt», erklärt Annen. In Mischzonen hingegen sind Wohnbauten möglich, sofern diese mit den gewerblichen Nutzungen verträglich sind. Zulässig sind dort nicht oder nur mässig störende Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe. Die Gemeinden legen fest, in welchem Verhältnis die verschiedenen Nutzungen zueinanderstehen dürfen. Wichtig ist, dass Wohnen und Arbeiten sich nicht gegens– das führt zu Konflikten. Sie haben eben auch ihre Tücken.»
Erschliessung ist Sache der Bauherren
Ein Bauprojekt kommt nur dann zustande, wenn das Grundstück erschlossen ist. Das Raumplanungsgesetz verlangt, dass ein gesicherter Zugang zu öffentlicher Strasse, Wasser, Strom und Abwasser vorhanden ist. Diese Anforderungen müssen spätestens in der Phase der Baubewilligung erfüllt sein. Der Generelle Erschliessungsplan regelt die verkehrstechnische, energetische und versorgungstechnische Erschliessung. Eine unzureichende Erschliessung kann zu Verzögerungen führen oder hohe Zusatzkosten verursachen. «Wer glaubt, dass die Erschliessung Sache der Gemeinde ist, liegt falsch. Gerade bei gewerblichen Projekten trägt oft der Bauherr die Verantwortung und die Kosten», erklärt Annen. «Und im Vergleich zu Wohnbauten sind bei gewerblichen Bauten bei der Erschliessung teilweise andere Anforderungen vorhanden.»
Rechtliche Vorgaben und Einsprachen
Ein Bauvorhaben kann auf Widerstand bei Anrainer/innen oder einspracheberechtigten Dritten stossen. Besonders dann, wenn Abstände unterschritten oder Rechte Dritter tangiert werden. Dazu gehören bspw. auch Lärmemissionen. Daher ist es sinnvoll, frühzeitig das Gespräch mit den entsprechenden Personen zu suchen. Annen rät dazu, Abmachungen mit Nachbarn «nicht bloss mündlich zu treffen, sondern schriftlich festzuhalten und diese juristisch richtig aufsetzen zu lassen». Je nach Situation ist sogar eine öffentliche Beurkundung erforderlich, etwa bei Dienstbarkeiten oder bei baurechtlichen Vereinbarungen. Neben dem Baugesetz gelten bei Bauprojekten zahlreiche weitere rechtliche Vorschriften. Diese betreffen etwa den Gesundheits-, Umwelt- und Gewässerschutz, den Lärm- und Brandschutz, die Energievorschriften sowie die Arbeitsgesetzgebung. Besonders wichtig sind auch Vorgaben zur Energieeffizienz sowie zur Wohnhygiene oder zur Pflicht zur Erstellung von Kinderspielplätzen bei grösseren Wohnbauten. «Viele Bauherren unterschätzen die Vielzahl an Vorschriften und glauben, mit einer Baubewilligung sei alles erledigt. Dem ist nicht so. Wer keine Fachleute beizieht, handelt leicht fahrlässig», warnt Annen. Auch die Einhaltung von Grenz- und Gebäudeabständen wird gelegentlich unterschätzt oder wenn nicht genügend Parkplätze geplant oder umgesetzt werden. «Das sind keine Bagatellen. Wer sich über gesetzliche Vorgaben hinwegsetzt, riskiert Rückbauverfügungen und hohe Kosten.»
Wenn das Bauprojekt in Stockwerkeigentum (STWEG) aufgeteilt werden soll, sind besondere rechtliche Anforderungen zu beachten. Die Aufteilung der Einheiten, die Nutzung der gemeinschaftlichen Flächen sowie die Kostenverteilung müssen präzise geregelt werden. Die Begründung des Stockwerkeigentums muss öffentlich beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden. Besonders wichtig ist ein gut ausgearbeitetes Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft. «In der Praxis führen schwammige Regelungen fast zwangsläufig zu Konflikten unter Miteigentümern. Im Nachhinein Reglemente einer STWEG anzupassen, ist meist schwierig, da alle Parteien zustimmen müssen», erklärt Annen.